 Burgenland
BurgenlandNach mehreren Vorfällen konnte ein erfolgreiches Sicherheitsforum das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Klingenbachs erhöhen.
Durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) wurde an der ehemaligen Grenzkontrollstelle Klingenbach eine Betreuungseinrichtung errichtet. In der Einrichtung können bis zu 80 Asylwerberinnen und Asylwerber betreut werden. Aufgrund mehrerer Vorfälle mit den Asylwerberinnen und Asylwerbern stieg die Verunsicherung der Bevölkerung von Klingenbach.
Zusätzlich befindet sich die Unterkunft außerhalb des Ortsgebiets, wodurch sich auch die Asylwerberinnen und Asylwerber in Gefahr brachten, da sie bei schlechter Sicht und Dunkelheit zu Fuß und ohne Warnweste die Fahrbahn benutzten.
Um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, wurden im Rahmen eines Sicherheitsforums mit dem Bürgermeister der Gemeinde Klingenbach, dem Amtsleiter, Vertreterinnen und Vertretern der Betreuungseinrichtung und der Polizei einige Maßnahmen umgesetzt. Beispielsweise wurde die Polizeipräsenz in der Gemeinde erhöht und den Asylwerberinnen und Asylwerbern besonders die Verhaltensregeln in der Unterkunft sowie im Straßenverkehr nähergebracht. Auch auf das Tragen einer Warnweste oder reflektierender Armbänder im Straßenverkehr wurde hingewiesen. Weiterhin auffällige Asylwerberinnen und Asylwerber wurden in anderen Betreuungseinrichtungen untergebracht.
Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung konnte durch intensive Gespräche erhöht werden und die Maßnahmen waren nach Rückmeldung der Sicherheitskoordinatoren und Sicherheitsbeauftragten des Stadtpolizeikommandos Eisenstadt erfolgreich.
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel des Alkohol - und Betteleiverbots in der Innenstadt in Eisenstadt
Häufig auftretende Bettelei an öffentlichen Plätzen, verstärkter Alkoholkonsum, Verunreinigungen und Lärmbelästigungen im Zentrum von Eisenstadt, wodurch sich Passanten, Geschäftsleute und Anrainer unsicher fühlten.
Gemeinsam mit den Sicherheitspartnern der Stadt, den Sicherheitsbeauftragten, den Bediensteten der Magistratsabteilung und den anrainenden Geschäftsleuten konnte die Früherkennung größerer Ansammlungen von Bettlern und Obdachlosen erzielt werden. Noch vor der Entstehung einer Lage, die zu Beschwerden geführt hätte, konnten konkrete Maßnahmen und Kontrolltätigkeiten zur Zerstreuung und Verlagerung der Bettlerproblematik gesetzt werden. Des Weiteren konnten durch die gemeinsame Erarbeitung des Aktionsplans, mit Hinweisen zum Alkoholkonsumverbot, Alkoholmissbräuche an öffentlichen Plätzen verringert werden. Auch wenn diese Art der Maßnahmen nicht in den direkten Zuständigkeitsbereich der Polizeibeamten fällt, konnte durch die Bereitschaft der Zusammenarbeit eine gemeinsame Lösung gefunden und eine ortspolizeiliche Verordnung des sektoralen Alkohol- und Betteleiverbots auf Straßen und öffentlichen Plätzen der Innenstadt beschlossen werden.

Foto: SK Ernest Bogner / LPD Eisenstadt
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel von Graffitizeichnungen in der Innenstadt Eisenstadt
Im Probebezirk Eisenstadt kam es in der Vergangenheit vermehrt zu nächtlichen Vandalismus- Handlungen in Form von Graffitizeichnungen auf öffentlichen und privaten Gebäuden.
Durch die intensive Zusammenarbeit der SB mit der Bevölkerung soll die Ausweitung von Vandalismus verhindert und eine Sensibilisierung gestartet werden.
Erfahrungen aus der Praxis am Beispiel eines Unterstandslosen in einer leerstehenden Gerätehütte in Eisenstadt
Eine Gruppe von obdachlosen Menschen nutzte unerlaubterweise eine leerstehende Gerätehütte auf einem brachliegenden Grundstück als Quartier. Auch das Nachbargrundstück wurde von den Grundstückseigentümern nicht benutzt.

Foto: SK Ernest Bogner / LPD Eisenstadt
Die obdachlosen Menschen konnten in sozialen Einrichtungen untergebracht werden. Da die verfallene Gartenhütte nicht mehr gebraucht wurde, einigte man sich auf den Abriss. Damit wurde das Problem gelöst. Der Schlüssel lag in der raschen Vernetzung der einzelnen Beteiligten.
 Kärnten
KärntenAm 12. Februar fand ein großer Sicherheitstag im Kärntner Skigebiet Petzen statt. Im Vordergrund stand die ordnungsgemäße Benutzung der Pisten.
Neben diversen Besucherinnen und Besuchern auf Ski, Snowboard oder Tourenski, nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Bergwacht, Skischule und Bergbahnen teil. Ziel der Veranstaltung war die Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler im Rahmen von „GEMEINSAM.SICHER“ auf eine vorbildliche Nutzung der Pisten hinzuweisen.
Initiiert wurde die Veranstaltung von Markus Hoffmann, Polizeiinspektionskommandant von Bleiburg: „Der Sicherheitstag soll ein Impuls dafür sein, sich in den Skigebieten entsprechend zu verhalten. Das bedeutet vor allem die zehn FIS-Pistenregeln zu beachten, so wie man sich auch an die Gesetze im Straßenverkehr halten muss.“
Auch für die Benützer des „Flow Country Trail“ auf der Petzen, einer der längsten Mountainbike Trails Europas, ist geplant einen Sicherheitstag abzuhalten.
 Niederösterreich
NiederösterreichIn St. Pölten Wagram gibt es eine Wohnhausanlage mit ca. 1200 Bewohnern. In dieser Anlage kam es jahrelang nahezu wöchentlich, immer wieder zu Kellereinbrüchen und Fahrraddiebstählen.

Im Zuge der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ wurde gezielt in zahlreichen Gesprächen auf die Sicherheitsbedürfnisse der Mieter eingegangen. Dabei gelang es, einen Sicherheitspartner in der Anlage zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Partner wurden die Probleme im Rahmen eines Sicherheitsforums diskutiert und Lösungsvorschläge erarbeitet.
Neben Schwierigkeiten im Zusammenleben konnten auch technische Probleme wie defekte Türschließer, fehlende Schlösser zu Kellereingängen, defekte Beleuchtung, defekte Hauseingangstür, benannt werden. Gemeinsam mit dem Sicherheitspartner und der verantwortlichen Wohnungsgenossenschaft konnten die technischen Mängel behoben werden.
Weiters führte die Polizei im Zuge einer Mieterversammlung einen Präventionsvortrag zum Thema „Sicherheit in Wohnhausanlagen“ durch, an dem auch die örtliche Feuerwehr beteiligt war.
Die Gemeinde Rabenstein an der Pielach liegt im Herzen des Pielachtals im Bezirk St. Pölten Land, Niederösterreich und verfügt neben einem Kindergarten auch über eine Schule. Die NMS Rabenstein liegt im verbauten Ortszentrum der Gemeinde.

Foto: © Auer Gottfried
Die Schule ist zwar sehr gut erreichbar, jedoch durch den starken Pendlerverkehr insbesondere in den Morgenstunden stark befahren. Die Schulkinder werden mit Bussen aus den verschiedenen Ortsteilen Rabensteins sowie aus der Gemeinde Hofstetten-Grünau zur Schule gebracht. Zur Erreichung der Schule muss zirka die Hälfte der Schulkinder die Bundesstraße queren. Dazu ist ein Schutzweg angebracht. Die Schulwegsicherung kann von der Polizei Rabenstein aus personellen Gründen allerdings nicht dauerhaft wahrgenommen werden. Diese Situation war für Eltern, Schule, Gemeinde sowie Polizei nicht zufriedenstellend.
In einem ersten Schritt wurde ein Sicherheitsforum mit den wesentlichen Stakeholdern im Gemeindeamt Rabenstein einberufen. Die Ausgangslage wurde besprochen und Anforderungen konkretisiert. Vorgeschlagen wurde, durch die Miteinbindung von Bürgerinnen und Bürgern einen permanenten Schülerlotsendienst zu installieren, dessen Ausbildung die Polizei übernimmt. Das Vorhaben, die Schulwegsicherung wieder durch Schülerlosten zu gewähren, wurde beschlossen und sämtliche dazu nötige Aufgaben vergeben. Der Bürgermeister stellte das Projekt im Gemeinderat vor und warb aktiv für die Teilnahme.
In einem zweiten Schritt fand im Gemeindezentrum Rabenstein eine Informationsveranstaltung für alle interessierten, ehrenamtlichen Schülerlotsen statt. Der Sicherheitsbeauftragte erläuterte den Status Quo und das angestrebte Ziel. Interessierte erhielten umfassende Information über die rechtliche Stellung des Schülerlotsen nach der Straßenverkehrsordnung, die Ausstellung des Schülerlotsenausweises durch die BH St. Pölten und den damit beinhalteten Versicherungsschutz durch die AUVA und NÖ Versicherung. Die Einteilung der Dienste, Erstellung allfälliger Dienstpläne und Ersatzgestellungen wurde den künftigen Schülerlosten freigestellt. Mehrere Modelle wurden vorgestellt, sodass eine fundierte Entscheidungsgrundlage vorlag. Vorerst einigte man sich auf eine wochenweise Dienstverrichtung durch zwei Personen im gegenseitigen Austausch.
Durch das Zusammenwirken aller Beteiligten konnten sehr kurzfristig die nötige Infrastruktur und Ausrüstung erlangt werden. Die Einschulung durch die Polizei und der Versicherungsschutz schaffen Handlungssicherheit. Die freie Diensteinteilung funktioniert. Eine „Schülerlotsen“ WhatsApp Gruppe sichert die permanente Umsetzung auch bei kurzfristigen Verhinderungen einzelner Schülerlotsen. Durch die Beteiligungsmöglichkeit sind alle Betroffenen sowie die ehrenamtlichen Schülerlosten motiviert und agieren selbständig in ihren Bereichen.
Weitere Informationen unter: http://www.partizipation.at/
Dunkle öffentliche Räume werden oft als „Angsträume“ empfunden, beleuchtete Orte geben ein Gefühl der Sicherheit. Viele städtische Bereiche sind schlecht beleuchtet. Bei einer Befragung in Graz stellte sich heraus, dass manche Frauen Ängste auf dem Weg zur und von der Arbeit hatten, vor allem, wenn es früher dunkel wurde. Einige Betroffene wählten einen helleren, aber längeren Weg.
Bei einer „Licht.Tour“, einem Spaziergang im Dezember 2016, wurden in der Annenstraße und Umgebung Räume ausfindig gemacht, die ein Gefühl der Unsicherheit erzeugten. Das Ergebnis der „Licht.Tour“ wurde dem Straßenamt der Stadt Graz mitgeteilt, um Maßnahmen zur Verbesserung der Situation einzuleiten. Eine „Licht.Tour“ gab es am 30. November 2017 auch in St. Pölten. Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, Landespolizeidirektor Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler, St. Pöltens Bürgermeister Mag. Matthias Stadler und Stadtpolizeikommandant Oberst Franz Bäuchler absolvierten im Rahmen der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ die „Licht.Tour“ durch die Landeshauptstadt und orteten einige unsichere Stellen. Ziel war es, diese Unsicherheitsräume mit geeigneten Maßnahmen wie eine bessere Beleuchtung zu entschärfen.
Nach dem Auftakt in St. Pölten ist es geplant, die „Licht.Tour“ auf andere Städte in Niederösterreich auszuweiten.
Im Bereich des Hauptbahnhofs Wiener Neustadt, sowie dessen unmittelbarer Umgebung kam es immer wieder zum gruppenweisen Auftreten von Jugendlichen und zu vermehrten strafrechtlichen Delikten (Suchtgift und Diebstähle). Dies führte zu einem hohen Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung und den Geschäftsinhaberinnen und -inhabern.
Foto: © LPD Niederösterreich
Polizei:
ÖBB:
Magistrat Wiener Neustadt:
Zwischen der Waldzeile und der Klubstraße im Strombad Kritzendorf kam es durch freilaufende Hunde und Missachtung des Fahr-, Park- und Halteverbots zu gefährlichen Situationen mit Radfahrern.
Bei einem Sicherheitsforum wurde die Problematik von Bürgern an den Sicherheitsbeauftragten herangetragen. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Problemen, wenn Radfahrer zu schnell in die Klubstraße einbogen. Um dies zu verhindern, wurde eine geeignete Lösung gesucht.
Zur Geschwindigkeitsbegrenzung wurden auf dem schmalen Verbindungsstück zwischen Waldzeile und Klubstraße im Strombad Kritzendorf übergroße Natursteine (sogenannte „Wurfsteine“) platziert. Mit dieser Maßnahme soll mehr Sicherheit entstehen, vor allem für Kinder, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Weiters wurden Bodenmarkierungen „20 km/h“ aufgebracht bzw. erneuert. Außerdem wurden Hundeverbotsschilder erneuert und zusätzliche Schilder angebracht. Auf dem Treppelweg wurden Hinweisschilder „Achtung Kinder“ und am südlichen Ende des Strombades wurden Hinweisschilder „Radweg zum Donau-Rad-Wanderweg“ aufgestellt, um das Durchfahren des Strombades durch Radfahrer zu vermeiden.
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel eines Flüchtlingsbetreuungszentrums im Bezirk Mödling
Im Flüchtlingsbetreuungszentrum „Haus St. Gabriel“ im Bezirk Mödling mangelt es oft an ausreichend Betreuungspersonal, vor allem in den Nachtschichten. Besuche und anschließende Übernachtungsanfragen von nicht im Betreuungszentrum ansässigen Asylanten werden zunehmend als Problem angesehen. Dadurch konnte ein vermehrtes Unsicherheitsgefühl bei den Mitarbeitern des Betreuungszentrums wahrgenommen werden.
Durch die vermehrte Kontroll- und Streifentätigkeit der Polizei konnte eine rasche Beruhigung der Situation und die Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Mitarbeiter erzielt werden. Zusätzlich konnte die Kommunikation verbessert und so eine positive Einwirkung der Betreuer auf die Asylwerber erzielt werden.
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel des Bezirks Mödlings
Hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger gaben Fahrräder an Asylwerberinnen und Asylwerber weiter. Es kam zu Missverständnissen über die Eigentumsverhältnisse der Fahrräder. Vermehrt traten auch Verkehrsverstöße auf.
Durch die Kennzeichnung konnte einfach festgestellt werden, ob das Fahrrad rechtmäßig im Besitz der jeweiligen Person war. Es konnte ein Rückgang der Fahrraddiebstahlsanzeigen verzeichnet werden, die Beschwerden von ortsansässigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern haben abgenommen.
Am 17. Mai nahmen 28 Pensionistinnen und Pensionisten aus dem Stadtteil Pernau in Wels am Vortrag „GEMEINSAM.SICHER in den besten Jahren“ teil.
Im sogenannten „Generationentreff“ in Wels bekamen die Pensionistinnen und Pensionisten unter anderem Tipps zur Sicherung ihrer Eigenheime und zum Schutz vor Trickbetrug. Besonders interessiert waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schutz vor dem sogenannten „Neffentrick“ und den „falschen Polizisten“, da vorrangig ältere Personen als mögliche Opfer im Fokus von diesen Betrügerinnen und Betrügern stehen.
Mittlerweile nutzen viele älteren Personen das Internet, um Bankgeschäfte oder Einkäufe online zu erledigen, daher wurden die Anwesenden auch über Gefahren im Internet, Fake-Seiten und Erpresser-Mails informiert. Besonderes Interesse hatten die Teilnehmenden auch an den Themen „Sicher unterwegs auf Reisen“ und „Richtiges Verhalten beim Einkaufen“.
Anschließend an den Vortrag hatten die Pensionistinnen und Pensionisten noch die Möglichkeit in gemütlicher Runde sicherheitspolizeiliche Fragen und Anliegen vorzubringen. Die Fragerunde wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgiebig genutzt und bildete den Abschluss einer erfolgreichen Veranstaltung.
Best Practice am Beispiel der verbesserten Sicht in Kreuzungen im Bezirk Schärding
An einer unübersichtlichen Kreuzung im Probebezirk Schärding wurde ein gefährliches Verkehrssicherheitsproblem gemeldet. Dabei handelte es sich zum einen um eine Sichtbehinderung an einer Kreuzung wegen eines zu niedrig angebrachten Verkehrsspiegels, zum anderen um eine weitere Sichtbehinderung durch Sträucher.
Das Community Policing Projekt „Gemeinsam Sicher in Österreich“ ermöglicht eine barrierefreie, rasche Kommunikation zwischen den zuständigen Personen, im konkreten Fall der Gemeinde, und der Polizei, wodurch Probleme sehr schnell behoben und Problemlösungsprozesse in einem sehr kurzen Zeitrahmen durchgeführt werden können. Durch diese Maßnahme konnte eine wesentliche Verbesserung der Sicht bei der Kreuzung erreicht und somit die Verkehrssicherheit erhöht werden.
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel der verbesserten Sicht in Kreuzungen im Bezirk Schärding
Gerade in den Sommermonaten kommt es in Schärding zu Sichtbehinderungen durch Maisfelder. Speziell an Kreuzungen entstehen dadurch gefährliche Situationen, zum Beispiel an den Güterwegen „Pramau“ und „Schusteredt“.

Foto: Gerhard Gierlinger / PI Münzkirchen
Landwirt mähte das Maisfeld ab, so dass die Kreuzung wieder einsehbar ist. Durch das rasche und unbürokratische Handeln konnte die Verkehrssicherheit schnell wieder hergestellt werden. Es wurde außerdem mit der AMA geklärt, dass das Abmähen der Maisstauden keine Nachteile für den Landwirt zur Folge hat (z.B. „Berichtigung“ der Förderflächen), solange der Mais verfüttert wird.
 Salzburg
SalzburgIn einem Hotel in Wals/Siezenheim fand am 11. April 2022 eine Info-Veranstaltung der Polizei für ukrainische Kriegsflüchtlinge statt.
Der „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“-Sicherheitskoordinator des Bezirkspolizeikommandos Salzburg-Umgebung, Abteilungsinspektor Gottfried Kontschieder und dessen Kollegin, Bezirksinspektorin Eva-Maria Haid von der Polizeiinspektion Wals/Siezenheim, berichteten mit tatkräftiger Unterstützung einer Dolmetscherin vor 80 Kriegsflüchtlingen über die Aufgaben der österreichischen Polizei. Den Betroffenen sollte vor allem die Scheu vor der Polizei genommen und ihr Vertrauen in die österreichische Exekutive gestärkt werden.
Die Besucherinnen und Besucher erhielten Praxistipps zum Absetzen von Notrufen und den damit einhergehenden Erfordernissen. Zudem erörterten die Vortragenden rechtliche Fragestellungen, wie etwa zum Konsum von Alkohol auf öffentlichen Plätzen oder alltäglichen Dingen, wie das Aufsuchen von öffentlichen WC-Anlagen oder Gaststätten. Mit den beiden verantwortlichen Leitern der Unterkunft wurde bei dieser Gelegenheit ein steter Austausch vereinbart. Seitens der Unterkunftsleitung erfuhren die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort beste Unterstützung und erhielten zahlreiche positive Rückmeldungen.
Um die Sicherheit von Reisegästen in den Zügen, auf Bahnhöfen und generell bei Zugreisen zu erhöhen, sind ÖBB und Polizei eine Sicherheitspartnerschaft eingegangen. Dabei geht es um die Vermeidung von Sachbeschädigungen, aber auch um die Zusammenarbeit bei Großveranstaltungen. Besiegelt wurde diese Kooperation am 25. April 2022 am Grazer Hauptbahnhof.
Auf Bundesebene bestand bereits seit längerer Zeit eine Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit beim Thema Sicherheit zwischen dem Innenministerium und der ÖBB-Holding AG. Auf Landesebene wurde diese Partnerschaft nun intensiviert und offiziell besiegelt. Dazu traf sich der „GEMEINSAM.SICHER“-Verantwortliche, Generalmajor Joachim Huber, von der Landespolizeidirektion Steiermark mit den ÖBB-Vertretern Peter Wallis und Roman Hahslinger am Grazer Hauptbahnhof.
„Initiativen wie `GEMEINSAM.SICHER in den Urlaub´ thematisieren die Sicherheit in der gesamten Reisekette und tragen dazu bei, dass sich Menschen am Bahnhof und im Zug beschützt fühlen“, erklärte der stellvertretende Polizeidirektor Joachim Huber. Für das laufende Jahr 2022 sind weitere gemeinsame Maßnahmen gegen Vandalismus (speziell Graffiti), die Sicherheit in Zügen und an Bahnhöfen sowie die Zusammenarbeit bei Großveranstaltungen geplant. „Mit der offiziellen Besiegelung der steirischen Sicherheitspartnerschaft wollen wir von der steirischen Polizei den erfolgreich eingeschlagenen Weg mit den ÖBB auch im heurigen Jahr weitergehen“, so Huber.
Sorgenfreies Pendeln und Reisen
Auch für die ÖBB ist die Partnerschaft von besonderer Wichtigkeit. Mit täglich über 300 Zügen im steirischen Nahverkehr bringen die ÖBB rund 40.000 Fahrgäste an ihr Ziel. „Durch die nun geschlossene Partnerschaft mit der Landespolizeidirektion Steiermark wollen wir auch zukünftig unseren Kundinnen und Kunden eine sorgenfreie, zuverlässige und vor allem sichere Art des Reisens bieten. Gerade jetzt, wo alle wieder richtig durchstarten wollen, stehen wir als ÖBB in der Steiermark bereit", betonte Peter Wallis, Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG.
Sachbeschädigungen
Graffiti, Vandalismus aber auch andere Straftaten schaden den Kundinnen und Kunden, aber auch den ÖBB als Betrieb. Roman Hahslinger, Leiter Konzernsicherheit der ÖBB-Holding AG dazu: „Eines der Kernziele der ÖBB ist es, den Reisenden ein Gefühl der Sicherheit und auch des Wohlfühlens zu vermitteln. Die ÖBB setzen dabei auf ein engmaschiges Security Management durch ein professionelles Team, das sich mit allen Fragen der öffentlichen Sicherheit beschäftigt. Denn Sicherheit ist kein Zustand, sondern harte Arbeit – jeden Tag.“
Sachbeschädigungen und Graffiti verursachen der ÖBB-Personenverkehr AG allein in der Steiermark einen jährlichen Schaden von mehreren zehntausend Euro. Neben dem finanziellen Schaden kommt es dadurch auch zu einem verminderten Angebot und Zugausfällen im steirischen Bahnverkehr.
Großevents wie Formel 1, MotoGP und Airpower22 sorgen bereits jetzt für intensive Arbeitsgespräche zwischen den ÖBB und der Polizei. Die Anreise zu diesen Events ist mit logistischen und sicherheitsrelevanten Komponenten und Abstimmungen verbunden.
Bereits ein paar Tage nach der Pressekonferenz nahmen die gemeinsamen Vorhaben Fahrt auf. Die Landespolizeidirektion Steiermark unterstützt durch ihre Bereitschaftseinheit die ÖBB und bestreift gemeinsam mit den sogenannten „Mungos“ (Security-ÖBB) Züge aber auch bauliche Einrichtungen der Bahn. Die jeweiligen zu bestreifenden Bahnstrecken und Einrichtungen werden tagesaktuell festgelegt.
Auf Grund der Überfüllung in der Fahrradgarage am Hauptbahnhof Leoben hatte die Bevölkerung keinen Platz mehr, die Fahrräder dort abzustellen.

Foto: © LPD Stmk/Gimpel
Im August 2019 fand daher ein „Frühjahrsputz“ der Fahrradabstellplätze am Hauptbahnhof statt. Beamtinnen und Beamte der Polizei Leoben unterstützten diese Aktion der Stadtgemeinde und des Wirtschaftshofs Leoben und führten vor Ort Überprüfungen durch, ob die dort abgestellten Fahrräder gestohlen bzw. herrenlos waren . Herrenlose Fahrräder wurden daraufhin entfernt, gestohlene sichergestellt. Informationen zu den sichergestellten bzw. entfernten Rädern erhalten Bürgerinnen und Bürger in der zuständigen Polizeiinspektion.
Der Hauptbahnhof Leoben soll damit wieder ansehnlicher werden und der Bevölkerung wieder mehr Platz zur sicheren Verwahrung der eigenen Fahrräder bieten. An diesem Tag wurde aber nicht nur fleißig geputzt, sondern auch informiert. Polizistinnen und Polizisten der Kriminalprävention waren vor Ort und führten Beratungen betreffend Fahrradsicherung durch.
Ziel dieser Aktion war es, der Bevölkerung wieder mehr Platz zur sicheren Verwahrung der Fahrräder zu bieten. Insgesamt wurden 21 Fahrräder sichergestellt. Eines davon wurde an den Besitzer übergeben, die restlichen Fahrräder wurden in das Fundamt der Gemeinde gebracht.
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel des Grazer Hauptbahnhofes
Die Fahrgäste, Anrainer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bahnhofs haben sich bereits des Öfteren über die Verunreinigung des Bahnhofareals sowie über Unterstandslose, die ihre Lager in der Eingangshalle aufgeschlagen haben und dort nächtigen, beschwert. Außerdem kommt es vermehrt zu Alkoholmissbrauch und damit einhergehend zu Ruhestörungen, Pöbeleien und Drogenhandel. Auch sind der Bahnhof und die Bahnhofsumgebung ein beliebter Ort für Bandentreffen.
Durch die gesetzten Maßnahmen konnte das subjektive Sicherheitsgefühl der Bahnhofsbesucher und Anrainer des Bahnhofs gesteigert werden. Zusätzlich konnte der Drogen- und Alkoholkonsum im Eingangsbereich weitestgehend unterbunden und die Unterstandslosen aus dem Eingangsbereich an soziale Einrichtungen vermittelt werden. Der Kontakt und der ständige Austausch mit den Verantwortlichen werden nach wie vor aufrecht gehalten.
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel Kooperation mit den Verkehrsbetrieben
In der Grazer Innenstadt treten - vorrangig in Bussen und Straßenbahnen - immer wieder akut Taschendiebstahlsbanden auf. Die Polizei reagiert darauf unter anderem durch verstärkte Streifentätigkeit in den Fahrzeugen, was einerseits zeitverzögert erfolgt und andererseits, bedingt durch die plötzliche sichtbare Präsenz, mitunter ein Unwohlgefühl unter den Fahrgästen auslöst.
Ab Herbst 2016 nutzt die Polizei die sogenannten Infoscreens in den Bussen und Straßenbahnen der Grazer Verkehrsbetriebe sowie am Jakominiplatz, der den Hauptumsteigeplatz von Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel und damit den am stärksten frequentierten Ort in Graz darstellt. Mittels vorgefertigter Beiträge, welche die Betreiber auf Veranlassung der Polizei in das Programm einspielen, werden die Fahrgäste rasch über das vermehrte Auftreten von Taschendieben informiert. Die Diktion wird bewusst sachlich und neutral gehalten, um keine unbegründeten Ängste zu schüren. Parallel dazu werden in den Fahrzeugen Plakate angebracht, auf denen Verhaltenstipps für den Fall einer erfolgten Warnung bzw. eines Diebstahles, sowohl in deutscher als auch englischer Sprache, ersichtlich sind.
Durch die Einschaltungen können die Fahrgäste der Busse und Straßenbahnen zeitnah vor dem verstärkten Auftreten von Taschendieben gewarnt werden. Gleichzeitig wirkt diese Präventionsmaßnahme auch abschreckend in Richtung der potenziellen Täter.
Erfahrungen aus der Praxis am Beispiel der Siedlung am Prof.-Franz-Spath-Ring
Die Bewohner einer Siedlung am Professor-Franz-Spath-Ring in Graz-St. Peter fühlten sich nicht mehr sicher. Die Formierung einer Bürgerwehr stand im Raum.
Gründe dafür waren:
Die Probleme wurden in drei Workshops aufgearbeitet. Teilgenommen haben die Bewohner der Siedlung, die Sicherheitsbeauftragten, der stellvertretende Bezirksvorsteher, der Sicherheitspartner der Siedlung, Vertreter der Mediationsstelle für Nachbarschaftskonflikte des Friedensbüros Graz.
Alle beteiligten Personen wurden an einen Tisch gebracht. Durch die Vernetzung wurde die Kommunikation verbessert. Auch langfristig wird dieses aufgebaute, gegenseitige Vertrauen aufrecht erhalten bleiben. Durch diesen Vorgang konnte das subjektive Sicherheitsgefühl der Bewohner erhöht werden.
Erfahrung aus der Praxis am Beispiel des Grazer Volksgartens
Der Grazer Volksgarten, eine öffentliche Parkanlage im Stadtbezirk Lenz, wurde in der Vergangenheit von Menschen gemieden, weil Jugendliche mit Drogen gehandelt und Konflikte offen ausgetragen hatten. Der Volksgarten wurde zum Politikum und trat medial nur mehr negativ in Erscheinung. Das Ansehen des Parks verschlechterte sich immer mehr – und damit das subjektive Sicherheitsgefühl.

Foto: Jürgen Markowecz / LPD Steiermark
Die Polizei lud Anrainer zu einem Gespräch ein sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Graz, der Bezirksverwaltung, von Nichtregierungsorganisationen und der neben dem Park sich befindlichen „Evangelischen Kreuzkirche“. Die Beteiligten kamen zusammen, um gemeinsam als Sicherheitspartner der Polizei an Lösungen zu arbeiten. Es wurden Initiativen für Jugendliche ins Leben gerufen, unter anderem das Projekt „Volksgartendrehscheibe“, bei dem Asylwerberinnen und Asylwerber sowie Neuankömmlinge betreut werden, beispielsweise mit dem Angebot von kostenfreien Deutschkursen. Es wurde eine Ruhezone im Park geschaffen und regelmäßige Sprechstunden eines Polizisten gemeinsam mit Bezirksvertretern eingerichtet. Unterschiedliche Veranstaltungen trugen zur Belebung des Parks bei.
Das Image des Grazer Volksgartens hat sich ins Positive gewandelt, wodurch sich das Sicherheitsgefühl gesteigert hat. Aus der Initiative entstanden weitere Maßnahmen, z. B. die Sprach- und Lebensschule „Weichenstellwerk“ und die Etablierung des Sicherheitsinformationszentrums am nahe gelegenen Lendplatz.
 Tirol
TirolUnter diesem Motto initiierte die Polizeiinspektion Nauders im Bezirk Landeck in der Wintersaison 2021/2022 ein Projekt, dessen Ziel es war, die Vertrauensebene und die Vernetzung zwischen Bevölkerung und Polizei weiter auszubauen und die Anzahl der Skidiebstähle zu verringern.
In Zuge des Projekts stellte der Sicherheitsbeauftragte Kontakt zu den im Zuständigkeitsgebiet ansässigen Sportgeschäften her. Die Leiter und Mitarbeiter der Sportgeschäfte wurden hinsichtlich Kriminalprävention sensibilisiert.
Im Jahr 2018 kam es in Tirol zu 2400 Skidiebstählen, 2019 zu 2316 Skidiebstählen (2020 und 2021 sind aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht repräsentativ). Um diesen hohen Zahlen entgegenzuwirken, wurde die Priorität auf die Kriminalprävention, insbesondere die Prävention von Skidiebstählen, gelegt. Zu diesem Zweck wurde ein Formular zur Aufnahme von Skidiebstählen erstellt und an die Sportgeschäfte ausgehändigt. Anhand dieses Formulars wurden die Verkäufer darüber informiert, welche spezifischen Daten von der Polizei zur Aufnahme von Skidiebstählen benötigt werden und wie im Falle eines Diebstahls vorzugehen ist. Zugleich konnten sich die Beamtinnen und Beamten ein Bild über die diversen Sicherungsmaßnahmen der Sportgeschäfte machen und diesbezüglich wertvolle Informationen zusammentragen. Auch dieses Projekt zeigte, dass eine gute Vertrauensebene zwischen Bevölkerung und Polizei einen äußert positiven Einfluss auf die Zusammenarbeit hat. Die Rückmeldungen der Leiter der aufgesuchten Sportgeschäfte zeigten zudem, dass der direkte Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung als sehr positiv wahrgenommen und geschätzt wird.
Dem Ziel der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“, gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung die Sicherheit in Österreich zu stärken, kam man in Nauders durch dieses Projekt ein gutes Stück näher.
Ob das Ziel die Anzahl der Skidiebstähle zu verringern erreicht wurde, wird sich in der nächsten Saison zeigen.
 Vorarlberg
VorarlbergVon Mai bis Oktober 2022 legten die Polizistinnen und Polizisten in Bregenz etwa 3.500 Kilometer im Zuge von 41 Streifen auf ihren dienstlichen Fahrrädern zurück.
Vier E-Bikes und die persönlich zugewiesene Ausrüstung wurden von der Logistikabteilung beschafft. Von Mai bis Oktober wurden dann in Bregenz 41 Streifen mit den neuen E-Bikes durchgeführt. Im Rahmen dieser Fahrradstreifen wurden Festnahmen durchgeführt, Vergehen aufgenommen, Sicherstellungen eingehoben, Verkehrsunfälle aufgenommen, Verwaltungsanzeigen gelegt und Organstrafverfügungen ausgestellt. Es wurden Fahndungen, Überwachungen und Identitätsfeststellungen durchgeführt sowie andere Streifen bei ihrer Arbeit unterstützt. Insgesamt wurden dabei etwa 3.500 Kilometer mit den Fahrrädern zurückgelegt. Viele Kilometer davon in Überwachungsgebieten, die mit Polizeikraftfahrzeugen nur schwer oder nicht zugänglich sind.
Neben den Aufgaben des Exekutivdienstes lagen weitere wichtige Arbeitsschwerpunkte im Bereich des Bürgerinnen- und Bürgerkontaktes, des Community Policing und der Unfallprävention.
Die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen zum uniformierten Fahrraddienst waren sehr positiv. Daher wurde der uniformierte Fahrraddienst 2022 auch im Bezirk Feldkirch eingeführt.
Chefinspektor Herbert Steckel, Leiter der Polizeiinspektion Feldkirch, zur Einführung des uniformierten Fahrraddienstes: „Vom uniformierten Fahrraddienst erwarte ich mir vor allem eine Steigerung der direkten Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürger. Damit verbunden auch eine verstärkte Wahrnehmung der Polizei durch die Bevölkerung. Außerdem können Bereiche, in denen die Polizei normalerweise nicht sichtbar präsent ist, besser bestreift werden. Da auch die Sicherheitswache Feldkirch Fahrradstreifen durchführt, werden wir die Chance nutzen, gemeinsame Streifen zu planen und die bereits hervorragende Zusammenarbeit weiter verstärken.“
2021 wurde der uniformierte Fahrraddienst (uFD) mit E-Bikes in Bregenz in Vorarlberg umgesetzt. Nach einer Interessentinnen- und Interessentensuche wurden die Kolleginnen und Kollegen ausgebildet.
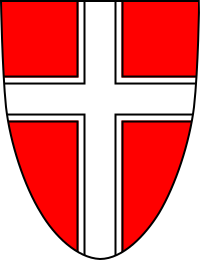 Wien
WienDie beiden Flüchtlingskinder Elias uns Maja aus Aleppo entwickelten nach ihren schrecklichen Kriegserlebnissen panische Angst vor der Exekutive. Am 18. März 2022 fand auf Wunsch und Ersuchen der verzweifelten Mutter ein Treffen mit Polizistinnen und Polizisten der Wiener Polizei statt, bei welchem ihnen die Angst genommen und das Vertrauensverhältnis neu hergestellt werden konnte.
Mit der ersten Flüchtlingswelle 2015 kam die Mutter von Elias (16 Jahre) und Maja (14 Jahre), eine Ärztin der klinischen Psychologie, nach Österreich. Ihre beiden Kinder musste sie damals aufgrund behördlicher Entscheidungen bei ihrem geschiedenen Mann in Aleppo (Syrien) zurücklassen.
Nach langen behördlichen Interventionen gelang es ihr Mitte Jänner 2022, Elias und Maja mit Hilfe des österreichischen Innenministeriums von Syrien über die Türkei nach Wien zu holen. Diese Rückholung war mit massiven Schwierigkeiten und Strapazen verbunden und wurde von der österreichischen Botschaft in Ankara koordiniert.
Die Kinder lebten sich rasch in Österreich ein und besuchten eine öffentliche Schule. Leider stellte die Mutter nach kurzer Zeit fest, dass beide Kinder – traumatisiert von den schrecklichen Erlebnissen des Krieges – panische Angst vor der Exekutive bzw. Menschen in Uniform haben. Bei einem Besuch in einem Wiener Spital erlitt Maja einen Nervenzusammenbruch und Elias kollabierte, als sie an einem uniformierten Security-Mitarbeiter des Spitals vorbeigehen mussten. Auch Majas täglicher Schulweg entwickelte sich für die 14-Jährige immer öfter zum Spießrutenlauf, da dieser an einer Polizeiinspektion vorbeiführte, was ihr panische Angst bereitete.
Die Kinder befinden sich seither in psychologischer Betreuung. Im Rahmen der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Wien“ wird nun versucht, den beiden ihre Angst vor der Polizei zu nehmen. Am 18. März 2022 fand auf Wunsch und Ersuchen der verzweifelten Mutter ein Treffen von Sicherheitskoordinator Daniel, Grätzl-Polizistin Nicole und Grätzl-Polizist Bernhard an der Wohnadresse der Familie statt. Ein persönliches Vorgespräch mit der Mutter erfolgte bereits Tage zuvor. Man einigte sich darauf, beim ersten Kennenlernen nicht in Uniform zu erscheinen, jedoch diese mitzubringen, um klar darzustellen, dass unter der Uniform ein Mensch aus Fleisch und Blut steckt, der nichts Böses will. Im Gegenteil: Ein Freund und Helfer, für den die Uniform nur ein Bekleidungsteil ist, das zur Wiedererkennung in unserer Gesellschaft dient.
So kam es, dass langsam ein Vertrauensverhältnis zwischen der Familie und den Grätzl-Polizisten aufgebaut werden konnte. Die mitgebrachten Uniformteile (Tellerkappe, Hose, Hemd) sowie Werbegeschenke von „GEMEINSAM.SICHER“ erweckten das Interesse der Kinder und sie begannen über ihre Ängste, Erfahrungen und Wünsche zu sprechen. Während des rund zweistündigen Besuches wurden die Exekutivbeamten mit regionalen, syrischen Spezialitäten verköstigt. Zum Abschied wurde auch noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto gemacht. Bevor die Grätzl-Polizisten gingen, äußerten die Kinder den Wunsch, dass die Beamten beim nächsten Treffen ihre Uniformen tragen sollen.
In einem Telefonat am 21. März 2022 berichtete die Mutter, dass Maja das erste Mal an der Polizeiinspektion auf ihrem Schulweg vorbeigegangen ist, ohne panisch zu werden. Voller Stolz habe die 14-Jährige dies auch ihren Freundinnen erzählt. Anhand dieses Erfolgs zeigt sich einmal mehr, wie wichtig die Arbeit der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ für unsere Gesellschaft ist.
Wir wünschen Elias, Maja und ihrer Mutter alles Gute für die Zukunft!
Zu den Personen:
Elias wurde in seiner syrischen Heimat Aleppo Opfer eines Bombenangriffs und erlitt dabei Verletzungen im Bereich des Beines. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.
Maja wurde nach einem Aufgriff der früheren al-Nusra Front, einer dschihadistisch-salafistischen Organisation in Syrien, mangels Tragens ihres Kopftuches in Gefangenschaft genommen. Sie wurde erst nach intensiven Verhandlungen wieder freigelassen.
Mehr Sicherheitsgefühl durch das Projekt „Licht“ im Bereich der U-Bahn Station Schottenring.
Der Bereich um die U-Bahn Station Schottenring (U2/U4) galt als Drogenverkaufsort, was zu einem negativen Sicherheitsgefühl und Abwertung der Wohngegend führte.
Das Projekt bekam positive Resonanz und wird derzeit in Eigenregie der Hausverwaltungen durch eine in der Gegend ansässige Elektrofirma umgesetzt. Zudem wird die Straßenbeleuchtung im Bereich der U-Bahn Station Schottenring auf LED Technologie umgerüstet, wofür die MA 33 zuständig ist. Das Sicherheitsforum hat das gesetzte Ziel erreicht.
Durch regelmäßigen Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Landespolizeidirektion Wien, der ÖBB und ihren Tochterorganisationen, den Wiener Linien, der Stadt Wien, des Immobiliendienstleisters ECE, der Wiener Wirtschaftskammer sowie den Institutionen am Westbahnhof kann das subjektive Sicherheitsgefühl im hochfrequentierten Einkaufszentrum am Wiener Westbahnhof gesteigert werden.
Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Personengruppen führte in der Vergangenheit mehrmals zu Streitigkeiten und teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen Jugendlichen. Im Sommer 2015 war der Westbahnhof eine der ersten Anlaufstellen für Asylwerberinnen und Asylwerber. Die Polizei reagierte mit höherer Präsenz und arbeitete gemeinsam mit den Transportunternehmen an erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Trotz objektiver Beruhigung der Situation verschlechterte sich seither das Sicherheitsgefühl der Passantinnen und Passanten am Westbahnhof.
Bei der regelmäßigen Analyse der Situation am Westbahnhof durch das Sicherheitsforum werden Sicherheitsmaßnahmen und geplante Veränderungen mit allen Beteiligten - Vertreterinnen und Vertretern der Landespolizeidirektion Wien, der ÖBB und ihren Tochterorganisationen, den Wiener Linien, der Stadt Wien, des Immobiliendienstleisters ECE, der Wiener Wirtschaftskammer sowie den Institutionen am Westbahnhof - besprochen. Das Sicherheitsforum brachte durch die gemeinsam initiierten Maßnahmen eine Verbesserung der Situation und eine Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls.
Ein Sicherheitsbeauftragter wurde bei einer Veranstaltung auf eine mögliche Gefahrenquelle für Schulkinder aufmerksam gemacht.
 LPD Wien_Daniel Zipfl.jpg)
Foto: Daniel Zipfl / LPD Wien
Aufgrund eines zu groß gewachsenen Strauches auf einem Schulweg am Alsergrund bestünde die Möglichkeit, dass es für Schulkinder zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen kommen könnte.
Kürzung des Strauches
Durch die Information einer besorgten Mutter an einen Sicherheitsbeauftragten konnte das Problem gleich vor Ort bestätigt werden. Nach Rücksprache mit der MA 33 wurde die Kürzung des Strauches vereinbart.
Vorgehen in Bezug auf das Thema Sachbeschädigung. Stichwort: Illegale Beschmierung von Wänden in der Seestadt Aspern.
Immer wieder kommt es in der Seestadt Aspern zu widerrechtlichen Beschmierungen von Wänden durch Graffitikünstler- und Künstlerinnen.
 BV22.jpg)
Foto: Bezirksvorstehung Wien 1220
Im Zuge eines Sicherheitsforums zum Thema Sachbeschädigung in der Seestadt kam es zu der Idee sechs Betonsäulen bei der U-Bahn Station „Seestadt“ für Graffitikünstler- und Künstlerinnen offiziell freizugeben.
Im Bereich der der Janis Joplin Promenade (unter der U-Bahn Trasse) wurden sechs Säulen aus Beton der U-Bahn Station „Seestadt" im Rahmen des Projektes „Wiener Wand“ den Graffiti Künstlern zur freien Benutzung übergeben. Durch die offizielle Freigabe der Betonsäulen finden Graffitikünstler sowie Künstlerinnen Platz, ihrem Talent freien Lauf zu lassen ohne dabei in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen. Durch das zur Verfügung stellen der Säulen können Graffitis dort entstehen, wo sie auch rechtmäßig gesprayt werden dürfen. Gleichzeitig soll auch ein Ort des Zusammenkommens für die Graffitiszene entstehen.